Wo bleibt Pharma 4.0?
Warum Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung in der pharmazeutischen Industrie nur langsam vorankommen
Es fehlt nicht an Prognosen, die dem Konzept „Industrie 4.0“ eine goldene Zukunft in Medizin und Pharmaindustrie vorhersagen. „Schon in wenigen Jahren werden Tabletten aus dem 3-D-Drucker zum Alltag gehören, genauso wie Virtual-Reality-Anwendungen im Krankenhaus“, prophezeit etwa der Mediziner und Fachautor Bertalan Meskó im Unternehmensbericht 2016 von Boehringer Ingelheim. „Von Science-Fiction lernen“: Unter dieser Überschrift spricht er von Sensoren in der Toilette, die Urin analysieren, sieht Ärzte mit Datenbrillen im OP hantieren und erwartet virtuelle, das heißt schnellere Testreihen von neuen Medikamenten. Ein Text im Magazin „Reinraum online“ über die komplett überwachte digitale Reinraumfertigung, an der unter anderem das Fraunhofer-Institut IPA arbeitet, trägt den Titel: „Wohlklingende Zukunftsmusik“. Das alles soll demnach schon bald Wirklichkeit werden.
Die Realität sieht anders aus. Abgesehen von den Schwierigkeiten, in Deutschland auch nur einzelne digitale Elemente wie eine elektronische Krankenakte einzuführen, kommt die Digitalisierung im Gesundheitssektor allgemein nur langsam voran. Speziell der Pharmabereich ist dabei keine Ausnahme, sondern ein notorischer Nachzügler. Eine Bestandsaufnahme.
Technologische Potenziale ohne Ende
Prozesse vernetzen, virtuell abbilden und analysieren: Die Potenziale einer Verschmelzung von virtueller und realer Welt in Pharmabetrieben ergeben sich aus einer Vielzahl neuer Möglichkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Diese Chancen bieten sich erst seit Kurzem. Gensequenzierungen beispielsweise und damit die Chance auf passgenauere, individuelle Behandlungen waren dank des technischen Fortschritts noch nie so einfach und billig zu haben wie heute. Riesige Mengen an digitalen Daten, wie sie durch Gentests oder Fitnessbänder gesammelt werden, sind mit Cloud-basierter Rechenkapazität betriebswirtschaftlich sinnvoll auswertbar geworden. Diese Rechenleistung können Firmen bei den großen Software-Konzernen je nach Bedarf mieten. Die Verknüpfung mit persönlichen Kundendaten, Bewegungs- und Social-Media-Profilen ermöglicht Prognosen: Per Auswertung in Echtzeit lassen sich Grippewellen regional vorhersagen. Die Produktion von Impfstoffen und Medikamenten könnte rechtzeitig hochgefahren werden.
Gleichzeitig erhöhen 4.0-Konzepte die Effizienz in der Produktion. Die industriellen Prozesse im Pharmabereich können von der Beschaffung über die mikrobiologischen Prüfverfahren und Medikamentenherstellung bis zur Logistik genauer als bisher kontrolliert und gesteuert werden – immer öfter ohne Zutun eines Menschen. Die Qualität der Produkte wird dabei durch die vorherige Bewertung des Produktionsdesigns und sensorgestützt durch die maschinelle Überwachung der Prozesse bis hin zur Verschleißprognose gesichert. Eine Schlüsselrolle fällt dabei der selbst lernenden Rechenleistung zu, der künstlichen Intelligenz (KI). Was bis vor wenigen Jahren Zukunftsmusik war, ist heute tatsächlich einsetzbar: Die großen Cloud-Dienstleister locken Unternehmen mit Software, die sich selbst schult. Nachdem diese zunächst das Regelsystem erfasst hat, etwa die Spielregeln von Schach, verbessert sie in raschem Tempo ihre Spielweise, bis sie nach wenigen Stunden unschlagbar geworden ist. Das funktioniert natürlich nicht nur mit Schach, sondern mit vielen Anwendungen und Regelkreisen. Da lernende KI sich selbst beschleunigen kann, sehen viele Fachleute die Menschheit nun an der Schwelle zu exponentiellem Wachstum.
Solche Chancen aus vermehrter Automatisierung, verbesserter Datenauswertung und digitaler Vernetzung – kurz Industrie 4.0 – gibt es in jeder Industrie. Technologisch gesehen wäre die pharmazeutische Industrie für Konzepte von Industrie 4.0 daher ein genauso geeigneter Kandidat wie jeder andere produzierende Wirtschaftszweig.
Für Pharmabetriebe wären sogar große positive Effekte zu vermuten. Da sie bereits heute die Produktionsqualität streng überwachen und dokumentieren müssen, um wirkstoffgleiche Chargen und keine Gefahren hervorzubringen, haben sie einen Anreiz, dies mit neuen Technologien kostengünstiger zu bewerkstelligen. Außerdem fertigen sie kapitalintensiv hochpreisige Produkte, was weitere Investitionen in den Fortschritt attraktiv macht. Automatisierung wäre für sie attraktiv, zum einen da sie den Menschen aus dem Produktionsprozess entfernt, der in der Reinraumfertigung kostenintensiv und im Gegensatz zu Maschinen fehlerträchtig ist. Zum anderen wären neue, innovative Produktionsdesigns möglich, außerdem höhere Fertigungsgeschwindigkeiten, neue Blockbuster-Medikamente und flexiblere Losgrößen, schnellere Zulassungsverfahren, kostengünstigere Forschung …
Medikamente 4.0: Wo bleiben sie?
So fantastisch die 4.0-Zukunft der Pharmaindustrie beschrieben werden kann, so ernüchternd fällt der Blick in die Gegenwart aus. „Die Betriebe, die neue Methodiken und Konzepte am meisten brauchen, die beschäftigen sich damit am wenigsten“, sagt Benedikt Fischer, CTO der ITELYA GmbH & Co KG, der Firmen auf dem Weg in die digitale Zukunft begleitet. Zu Fischers Kunden in Sachen Industrie 4.0 zählen z.B. Hotelbuchungsportale, Fin-Tecs, Maschinenbauer mit Online-Plattformen, Dokumentenmanagement- und ein Personaldienstleister, der 4.0-fähiges Personal ausbildet, „aber keine einzige Pharmafirma“.
Auch die Reinraumplaner von Dittel Engineering haben im Industriesektor zwar einige Kunden mit 4.0-Ambitionen, darunter aber nicht eine Pharmafirma. Umfragen zufolge ist Industrie 4.0 im Pharmabereich kein herausragendes Thema.
Zumindest war es das noch nicht im Jahr 2015, als die Unternehmensberatung Camelot 30 Manager von Pharmafirmen aus 16 Ländern dazu befragte. Die Führungskräfte erwarteten damals, dass es noch 15 Jahre brauche, ehe die Pharmabranche ihre Wertschöpfungskette digitalisiere und vernetze.
„Pharma 4.0“ bedeutet eine große Umstellung. Dieser Aufwand betrifft nicht nur die Produktion, sondern alle Unternehmensbereiche von der Beschaffung übers Personalmanagement bis zur Logistik. „Eine Maschine mit digitaler Schnittstelle ist nicht Industrie 4.0“, sagt Fischer. „Die ganze Wertschöpfungskette müsste digitalisiert sein.“ Versuche konsequenter Automatisierung gab es bei Medikamentenherstellern bislang nur in isolierten Projekten und Bereichen, auch weil die übergreifende Software dafür fehlte, komplexe Abläufe digital abzubilden und auszuwerten. Mögen in manchen Landstrichen die langsamen DSL-Verbindungen der Unternehmensdigitalisierung im Weg stehen, erklärt das nicht, dass auch Firmen mit ausreichender Anbindung weiterhin zögern.
Damit treten andere Gründe als Hemmnisse in der Pharmaindustrie hervor: marktstrukturelle, regulatorische und ethische.
Markt 3.0: Das lukrative Weiter-so
Erstens lässt sich mit den bisherigen Methoden im Pharmasektor noch richtig gut Geld verdienen. Die Branche ist es gewohnt, ihre Produkte mit hohen Margen absetzen zu können. In so einer bequemen Situation fehlt die Motivation, bisherige Abläufe über den Haufen zu werfen und Neues zu probieren.
Das heißt nicht, dass die Digitalisierung in der Branche nicht permanent diskutiert, betrachtet, bewertet wird. Und natürlich ist Martin Zentgraf zuzustimmen, dem Vorsitzenden des Bundesverbands der Pharmazeutischen Industrie (BPI), wenn er die 250 Mitgliedsunternehmen seines Verbands auf dem Unternehmertag im November 2017 auffordert, bei der Digitalisierung nicht auf andere zu warten: „Das werden wir selber übernehmen müssen.“ Dennoch richten sich Forderungen der Verbände der chemisch-pharmazeutischen Industrie in aller Regel zuerst an die Politik, etwa nach schnellerem Breitbandausbau, angepasstem Datenschutz und digitalen Ausbildungsinhalten. Sollten sich Investitionen in Industrie 4.0 positiv im Aktienkurs auswirken, würden wohl auch die Branchenriesen stärker als bisher aktiv werden. Manche kaufen mit ihren hohen Gewinnen derzeit aber lieber Aktien zurück, statt in die Vernetzung des Unternehmens zu investieren.
Behörden 1.0: Wettbewerb nicht vorgesehen
Zweitens ist im Pharmamarkt – anders als in anderen Märkten – nicht zu erwarten, dass kleine und neue Start-ups durch die Digitalisierung die Branchen aufrollen und den etablierten Platzhirschen das Fürchten lehren. Dafür sorgt das hohe regulatorische Normierungsniveau. Es wirkt im Pharmasektor wie eine Marktzutrittsbarriere für neue, technologisch wagemutige Wettbewerber. Die Gewährleistung hoher Qualität und der Schutz vor Produktfälschungen sind nämlich nur die eine Seite des strengen Regulierungsniveaus. Zur Kehrseite gehört, dass der regulierte Markt die Pharmakonzerne vor Konkurrenz schützt und ihnen den Erhalt von Marktmacht garantiert. Das lässt sich nicht nur in Europa, sondern auch in Japan und den USA beobachten: Die Länder, besonders Japan, verlangen höchste Standards, welche den Markt abgrenzen und die Eigenproduktion fördern.
Das strenge Regulierungsregime in Deutschland regelt bis ins Detail, wie Medizin produziert werden muss. Aspirin könnte mittlerweile robotertechnisch in einer Garage hergestellt werden. Das zu probieren, kommt jedoch keinem Start-up in den Sinn, da das Gesetz die Produktion explizit in einem Reinraum vorschreibt. Das unterscheidet den Pharmabereich von anderen Industrien, die keine derart strengen Produktionsgebote befolgen müssen. Industrieprodukte, etwa Gangschaltungen für Fahrräder, werden bereits hergestellt, ohne dass sie je eine Menschenhand berührt hätte – undenkbar in der Pharmaindustrie. Längst könnten Zytostatika für die Krebsbehandlung, die bislang per Hand zusammengemischt werden, von Robotern in eingehauster Umgebung effizienter hergestellt werden. Technologisch ist das möglich – nicht jedoch gesetzlich. Die Behörden sehen die Delegation lebenswichtiger Entscheidungen – und dazu gehört die Zusammenstellung von Medikamenten – an Maschinen nämlich skeptisch.
Auch die ungeklärte Frage der Produkthaftung bremst die weitere Automatisierung. Das betrifft die autonome Produktion ebenso wie das autonome Fahren, nur dass von Letzterem viel häufiger zu lesen ist. Wie beim sich selbst steuernden Auto können alle Sensorwerte der Welt nicht verhindern, dass es auch mal in der Werkhalle kracht. Das Produkthaftungsrecht gibt noch keine Antwort auf die Frage, wer bei Fehlern die Schuld zu tragen hat: der Hersteller des Roboters? Oder dessen Betreiber? Oder der Softwarehersteller, die zertifizierende Behörde, oder doch das aufsichtführende Bedienpersonal?
Der Mitarbeiter: nicht 4.0-ready
Drittens bedeutet Industrie 4.0 für die Pharmabeschäftigten sowohl Bedrohung als auch Chance. Während völlig klar ist, dass viele Arbeiten von Robotern statt von Menschen erledigt werden – dieser Tausch ist ja gerade das Ziel der digitalen Fabrik –, entstehen auf der anderen Seite neue Berufsbilder. Hierbei handelt es sich nicht um industrielle Facharbeit oder sogenannte Jedermannarbeitsplätze, sondern um Jobs für digitale Spezialisten. In Zeiten von Big Data sind Data Scientists gefragt, die in der Datenflut verwertbare Muster zu finden. Auch Software-Ingenieure, die mit KI umgehen können, werden in der neuen Arbeitswelt gebraucht. Vermehrt digitalaffine Mitarbeiter einzustellen, planten im Jahr 2016 über die Hälfte von 77 Führungskräften der Pharmabranche, die der Personaldienstleister Hays dazu befragt hatte.
Wer seinen Job in der Industrie 4.0 behält, wird sich umstellen müssen. Die Frage lautet, ob das Personal dazu bereit ist – und zwar in ethischer Hinsicht. Diese Frage klingt erst einmal irrelevant, aber die Ethik spielt in der Welt 4.0 eine große Rolle. Von den Menschen wird nämlich erwartet werden, dass sie sich Maschinen unterordnen. Dafür sind Beschäftigte weder ausgebildet worden noch von sich aus bereit.
Ein Beispiel: Die moderne Fabrik arbeitet mit automatischen Optimierungen von Prozessen, etwa von Laufwegen. Über die Datenbrille wird dem Mitarbeiter eingeblendet, wie der ideale Weg für ihn verläuft. Reinigungskräfte putzen und reinigen, von ausgewerteten Kamerabildern, Heatmaps und Partikelmessern gelenkt, gezielt an Stellen nach Bedarf. So praktisch das klingt, so krass sind die Voraussetzungen. 4.0 heißt nämlich: maximale Überwachung der Mitarbeiter. Darauf muss man die Beschäftigten vorbereiten. Sie müssen daran gewöhnt werden, dass ihre Umgebung überwacht wird, auch die Toilette. „Dass permanent eine Kamera im Raum ist, ist für viele erschreckend“, sagt IT-Fachmann Fischer. Darum benötigt die Umsetzung von Industrie 4.0 auch die Hilfe von Psychologen.
Verknüpfen lässt sich die Dauerüberwachung zudem mit Bewertungsverfahren, wie sie für soziales Wohlverhalten in China erprobt werden. „Diese Methoden werden vor den Betrieben nicht haltmachen“, so Fischer. Mit welchem Bein ein Kollege aufgestanden ist, erkennt die von Kamerabildern gespeiste Cloud-Software demnach bereits, wenn der Mitarbeiter auf dem Parkplatz aussteigt und sich dem Gebäude nähert. Je nach Analyse von Gang, Mimik, Temperatur kann ihm der Zugang gestattet oder verwehrt werden. Erst recht gilt das für Betriebsfremde. Wurde deren Verhalten schon im Vorfeld analysiert, stellt sich nicht erst beim Iris-Scan heraus, ob sie auf dem Firmengelände etwas zu suchen haben. Die Identität aller Anwesenden zu verifizieren, ist gerade in Pharmabetrieben besonders wichtig. Wenn dort Substanzen in falsche Hände gelangen, birgt das höchste Risiken. Bei der Herausgabe von Gefahrgut wird der Mensch – ähnlich wie bereits bei Atomsprengköpfen – immer stärker durch Maschinen kontrolliert oder verdrängt.
Dass Industrie 4.0 ethisch problematisch ist, zeigt auch die Prioritätensetzung im Brandfall, die einer Rangumkehr gleichkommt. Wenn in teuren Rechenzentren ein Brand ausbricht, werden die Menschen zwar noch aufgefordert, rasch das Gebäude zu verlassen. Nach einer kurzen Frist lässt sich das automatische Löschsystem aber durch nichts davon abhalten, die Halle mit Stickstoff zu fluten, um den Maschinenpark zu retten. Machines first – Men second.
Szenarien für die Pharmabranche
Industrie-4.0-Konzepte treffen in der Pharmaindustrie also vor allem auf Bedenken und Beharrung – allerdings nicht auf allen Kontinenten. Der bremsende Einfluss von Normen und Ethik fehlt in manchen anderen Ländern. Die Diskrepanz zwischen dem, was erlaubt ist, zieht bereits heute fähiges Personal zur Arbeit in die Ferne, etwa die USA. Wer die Freiheiten von Pharmaindustrie 4.0 testen will, der geht ins Ausland. Neue Produktionsverfahren und Arbeitsformen, die bei uns (noch) nicht genehmigungsfähig sind oder nicht als ethisch vertretbar gelten, werden anderswo zum Einsatz kommen.
Das sollte Anlass zum Umdenken geben. Kommt es nicht dazu, wird sich die einheimische Forschung und Produktion entweder komplett in Länder wie China verlagern. Oder die Fertigungstiefe hiesiger Hersteller sinkt bis zu einem gewissen Grad und wird um zugekaufte, GMP-konforme Komponenten ergänzt. Unsere qualitativ hochstehenden, aber innovationsarmen Pharmahersteller werden dann mit innovativen Firmen konfrontiert werden, die geringerer Regulierung unterliegen. Trotz aller Hindernisse wird die Industrie 4.0 in der Medizin- und Pharmabranche nicht auf Dauer aufzuhalten sein. „Bei der IT wird alles versucht werden, was geht“, sagt Benedikt Fischer!“
„Die maximale Digitalisierung wird kommen.“ Wenn nicht hier, dann anderswo“

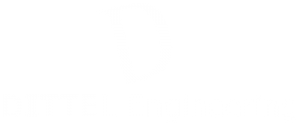




 DITTEL Engineering
DITTEL Engineering